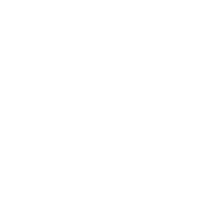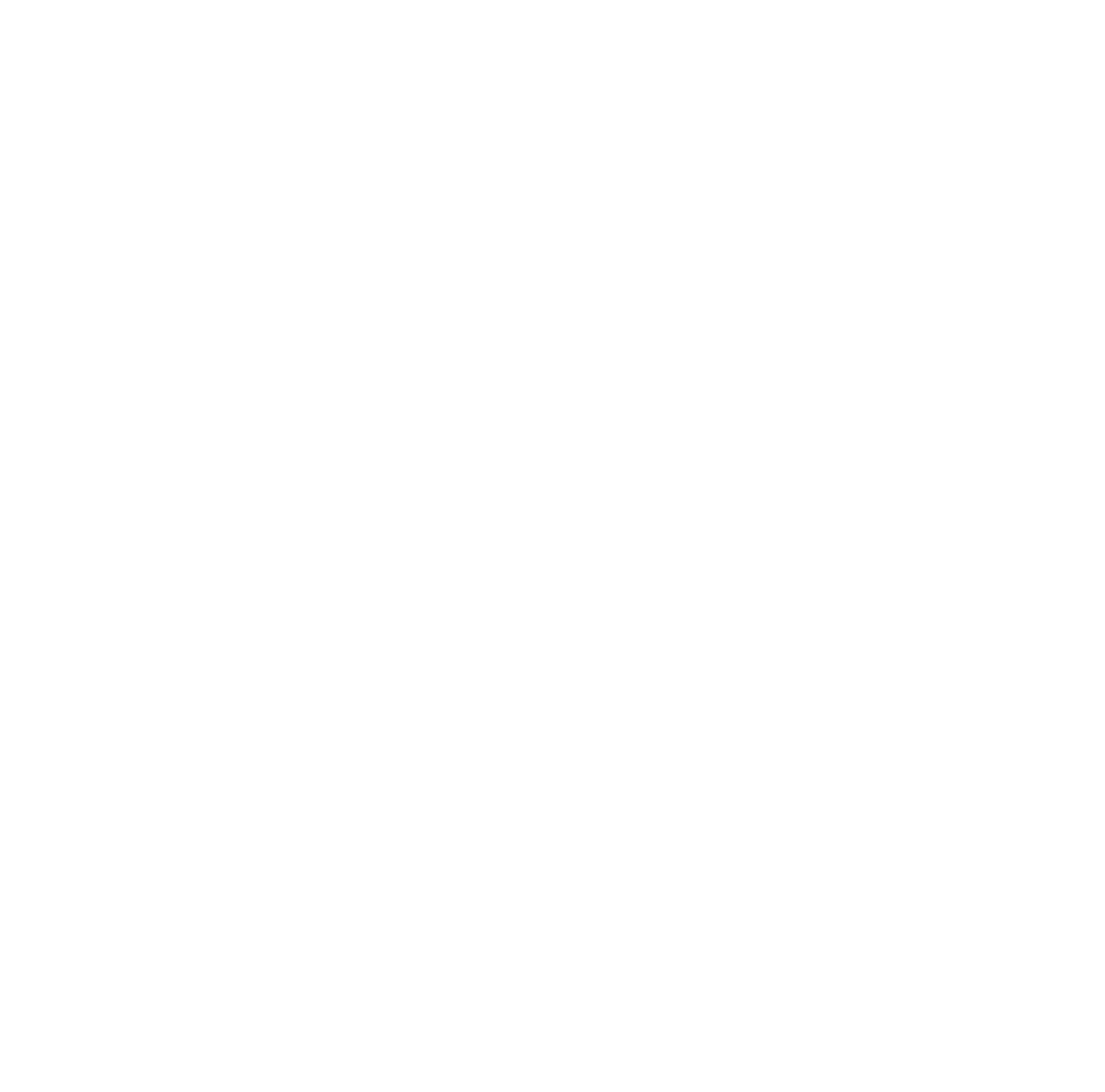10 Jahre Massaker von Kocho

Im Nordirak fliehen hunderte Binnenvertriebene aus den Flüchtlingslagern zurück nach Shingal. Nach einer Aussage eines jesidischen Generals am Gedenktag an den Völkermord von 2014, die radikale Muslime als Provokation missverständlich aufgenommen haben, sind zahlreiche jesidische Familien wieder von islamischem Extremismus bedroht. Trotz der weiterhin starken Zerstörung in Shingal sehen viele die Rückkehr dorthin als den sichersten Ausweg vor der Bedrohung. Foto: IGFM
Kommentar
Kein Ende für das jesidische Leiden unter islamischem Extremismus
Ein IGFM-Kommentar in Gedenken an das Dorf Kocho, dem Heimatdorf der Friedensnobelpreisträgerin Nadja Murad, in dem am 15. August 2014 der IS die jesidischen Frauen von ihren Familien trennte und verschleppte. Die Männer wurden hingerichtet und in Massengräbern verscharrt. Sie hatten elf Tage Zeit zum Islam zu konvertieren, entschieden sich dagegen und mussten auf brutale Weise mit ihrem Leben bezahlen. – Frankfurt am Main, 15. August 2024
Seit Juni und Juli ist die Rückkehr der jesidischen Familien nach Shingal ein immer wieder präsentes Thema, insbesondere seit der Ankündigung, dass die Flüchtlingslager in diesem Jahr geschlossen werden sollen. In den Medien herrschten viele Diskussionen über die Vor- wie auch Nachteile, die sich für die traumatisierten Binnenvertriebenen ergeben. Seitdem sind hunderte Familien in die Region Shingal zurückgekehrt, darunter sind ebenfalls Teilnehmer unserer Ausbildungsprojekte.

Stammt aus Kocho, Friedensnobelpreisträgerin Nadia Murad. Foto: U.S. Department of State/public domain
Missverständnis provoziert radikale Muslime
Am 3. August 2024 wurde dem 10. Jahrestag des Massakers an den Jesiden durch den IS gedacht. Anlässlich dieses Tages hielt der jesidische General Qasim Shasho eine Rede. Er ist Mitglied in der Barzani Partei PDK und befindet sich seit 2014 in Shingal, wo er eine jesidische Verteidigungseinheit unterhält. Ihm unterstellt sind über 1.000 Peschmerga. Der Gedenktag löst bei den Überlebenden des Massakers viele Emotionen aus. Qasim Shasho traf innerhalb seiner Rede die folgende Aussage: „Solange es den Namen Mohammed gibt, gibt es immer Massaker gegen uns“. Diese Behauptung löste daraufhin eine religiöse Eskalation innerhalb Kurdistans und Teilen des Iraks aus.
Nach Artikel 372 des irakischen Strafgesetzbuches ist es verboten, heilige Figuren der Religionen zu beleidigen. In Anbetracht dessen herrscht jedoch keine Gleichbehandlung zwischen den Religionen. Die jesidische Gemeinschaft wurde über die Jahre immer wieder von unterschiedlichen Teilen der Bevölkerung beleidigt oder angegriffen, ohne dass die Täter dafür Konsequenzen zu tragen hatten. General Qasim Shasho wurde nach dieser Aussage sowohl von der kurdischen als auch der irakischen Justiz unter Druck gesetzt. Beide haben einen Haftbefehl gegen ihn erlassen. Beistand erhielt Shasho von der kurdischen Regionalregierung (KRG) und einem arabischen Scheich, welche einen weiteren Völkermord an den Jesiden verhindern wollen. In einem späteren Statement versicherte Shasho, dass seine Aussage missinterpretiert worden sei, er habe alle Extremisten ansprechen wollen.
Die Reaktion radikaler Muslime war folgenschwer: Etwa 25 Geistliche nutzten die Freitagspredigt, um Hassreden gegen die jesidischen Familien zu verbreiten. Sie nutzten unter anderem die sozialen Medien für die Verbreitung und verdienen teilweise sogar Geld mit dem Werben für Gewalt gegen Jesiden. Sie drohten damit, dass das jesidische Leben nach den Freitagsgebeten enden würde, was zu großer Angst und Panik unter den jesidischen Familien in der Region führte. Schiitische Imame versuchten sich deeskalierend für eine friedliche Koexistenz in der Region Shingal auszusprechen, denn auch Schiiten waren Opfer des Völkermords 2014.
Flucht aus Angst vor Gewalt
Es folgte eine große Fluchtwelle der jesidischen Familien zurück in Richtung Shingal. Um den Weg in die Region anzutreten, stehen den Flüchtenden zwei mögliche Straßen zur Verfügung: zum einen vorbei an der Checkpoint-Kontrolle bei dem Fluss Faysh Khabur und entlang einer 150 km langen Strecke bis nach Shingal, zum anderen die Straße über Mosul und Tal Afer, die sich insgesamt auf 250 km beläuft und ebenfalls eine Checkpoint-Kontrolle enthält. Die Checkpoint-Kontrollen wurden von dem irakischen Ministerium für Migration und Vertreibung eingerichtet. Bei dieser Gelegenheit registrieren sie nach Shingal rückreisende Familien und geben das in ihren Statistiken als Erfolg des Plans der Schließung der Flüchtlingslager aus. Die Tatsache, dass die Vertriebenen in der aktuellen Situation aber aus Angst vor ausschreitender Gewalt flüchten, wird dabei unterschlagen.
Kein Entkommen vor muslimischen Extremisten
Die gesamte Region, durch die die Straßen verlaufen, liegt in fast ausschließlich muslimischen Siedlungsgebieten. Als 2014 der IS die jesidischen Dörfer angriff, umzingelte die Terrormiliz Shingal von Norden sowie von Süden und mobilisierte radikale Muslime aus den umliegenden Dörfern, um die Flüchtenden ebenfalls anzugreifen. Alte Traumata werden durch die aktuelle Flucht wieder aktiviert und lösen Angst und Panik bei den Flüchtenden aus.
Die Lager Bersve 1 und 2, Darkar, Cham Meshko und das Lager Qadian befinden sich alle in der Nähe der Stadt Zakho, in der viele radikale Prediger islamischen Extremismus verbreiten. Alle Lager sind von muslimischen Anwohnern umgeben. Das Lager Bajid Kandala verzeichnete auch eine große Zahl vertriebener Familien. Auch Teile der Lager Sharia, Esyan, Shekhan, Mam Rashan und das Lager Kabrato, in dem unser Projekt angesiedelt ist, waren betroffen. Von dort wird auch über eine große Rückkehrbewegung nach Shingal berichtet. Unser Projekt wird trotz der akuten Lage weiter fortgeführt und Ersatzteilnehmer erhalten dadurch ebenfalls eine Chance auf Ausbildung.
Traumata und langfristige Folgen der Bedrohung
Die Flucht und die Angst, der Gewalt durch kurdische, arabische oder türkische Extremisten ausgesetzt zu sein, wirkt sich schwerwiegend auf die psychische Gesundheit der Betroffenen aus: für die Erwachsenen, welche die Verantwortung für ihre Familien tragen, sowie für die Kinder, die große psychische Schäden und einen Mangel an Selbstbewusstsein erleiden, wenn sie aus ihrem gewohnten Lebensraum gerissen werden, weg von den aufgebauten Freundschaften und dem vertrauten Schulsystem (Bisher wurden sie nach dem Schulsystem der autonomen Region Kurdistan unterrichtet). Mit der Rückkehr nach Shingal ist es völlig unklar, wann sie wieder die Schule besuchen können und ob sie überhaupt die Chance auf ein gleichbleibendes System erhalten oder sich von Grund auf in ein neues System einarbeiten müssen.
Diejenigen Familien, die nicht die Möglichkeit hatten, das Lager zu verlassen, warteten auf die Hilfe der Sicherheitskräfte und harren mit großer Angst in den Lagern aus, in der Ungewissheit, ob sie dieselben Traumata eventuell nochmal durchleben müssen. Die Regierung der Autonomen Region Kurdistan beruhigte die Lage, indem sie Delegationen der Demokratischen Partei zu den Lagerverwaltungen und Sicherheitskräften schickte, damit sie sich um die vertriebenen Jesiden kümmern. Außerdem gibt es auch einige Vertriebene, die freiwillig in den Lagern geblieben sind. Oft sind darunter Vertriebene mit besonderen Berufen, wie beispielsweise Peschmerga oder Sicherheitskräfte der Lager. Sie lehnten die Rückkehr ab, weil die Gefahr zu hoch ist, dass sie ohne Job nach Shingal zurückkehren und infolgedessen ihr Einkommen endgültig verlieren, sowie außerdem der dauerhaften Gefahr, gefangengenommen zu werden, ausgesetzt wären. Die PKK oder schiitische Milizen könnten sie vor eine Anhörung stellen, wobei ihr Schicksal ungewiss wäre.
Schwieriger Neuanfang in der alten Heimat
Die Flüchtlinge, die nach Shingal zurückgekehrt sind, durchleben ähnliche Situationen wie 2014. Abgesehen von der ständigen Gefahr, die weiterhin für sie herrscht, kommen sie in eine zerstörte Region zurück, welche kaum Infrastruktur oder Lebenssicherheit bietet. Sie haben keine Häuser und wissen nicht, wo sie unterkommen sollen. Es herrscht Chaos. Während einige bei Verwandten unterkommen können, stehen andere vor dem Nichts. Kein Job mehr, kein Haus und keine Sicherheit. Viele Zukunftsfragen kann man zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht beantworten.
Neben den vielen negativen Aspekten könnten sich für die rückgekehrten Familien aber auch positive Lebensaspekte entwickeln: Zwar müssen sich die Familien um sich selbst kümmern und ein Leben aus dem Nichts aufbauen, sie bekommen aber die Chance, wieder Stolz und Würde zu empfinden und in einem eigenen Haus ohne Überwachungseinheiten zu leben. Sie können ihre alten Nachbarschaften wieder aufbauen und pflegen. Viele Familien mussten ihre ursprünglichen Berufe innerhalb der Flüchtlingslager aufgeben, weil sie dort nicht vonnöten waren. Zurück in Shingal bekommen sie die Chance, wieder ihren ehemaligen Beruf auszuüben, vor allem Landwirte oder Obstfarmer. Außerdem ist der Weg zu den zuständigen Behörden wieder deutlich näher und erleichtert den Familien die Antragsstellung von Dokumenten. Ein positives Leben in Shingal lässt sich aber erst erreichen, wenn keine Gefahr mehr durch den IS oder radikale Gruppen besteht und die jesidischen Familien in Sicherheit leben können.
Die IGFM leistet seit 2014 Humanitäre Hilfe in der Autonomen Region Kurdistan und ist regelmäßig in Kontakt mit Geflüchteten, Überlebenden und Angehörigen der Opfer und gibt ihnen eine Stimme.
Fotos: IGFM