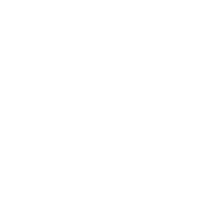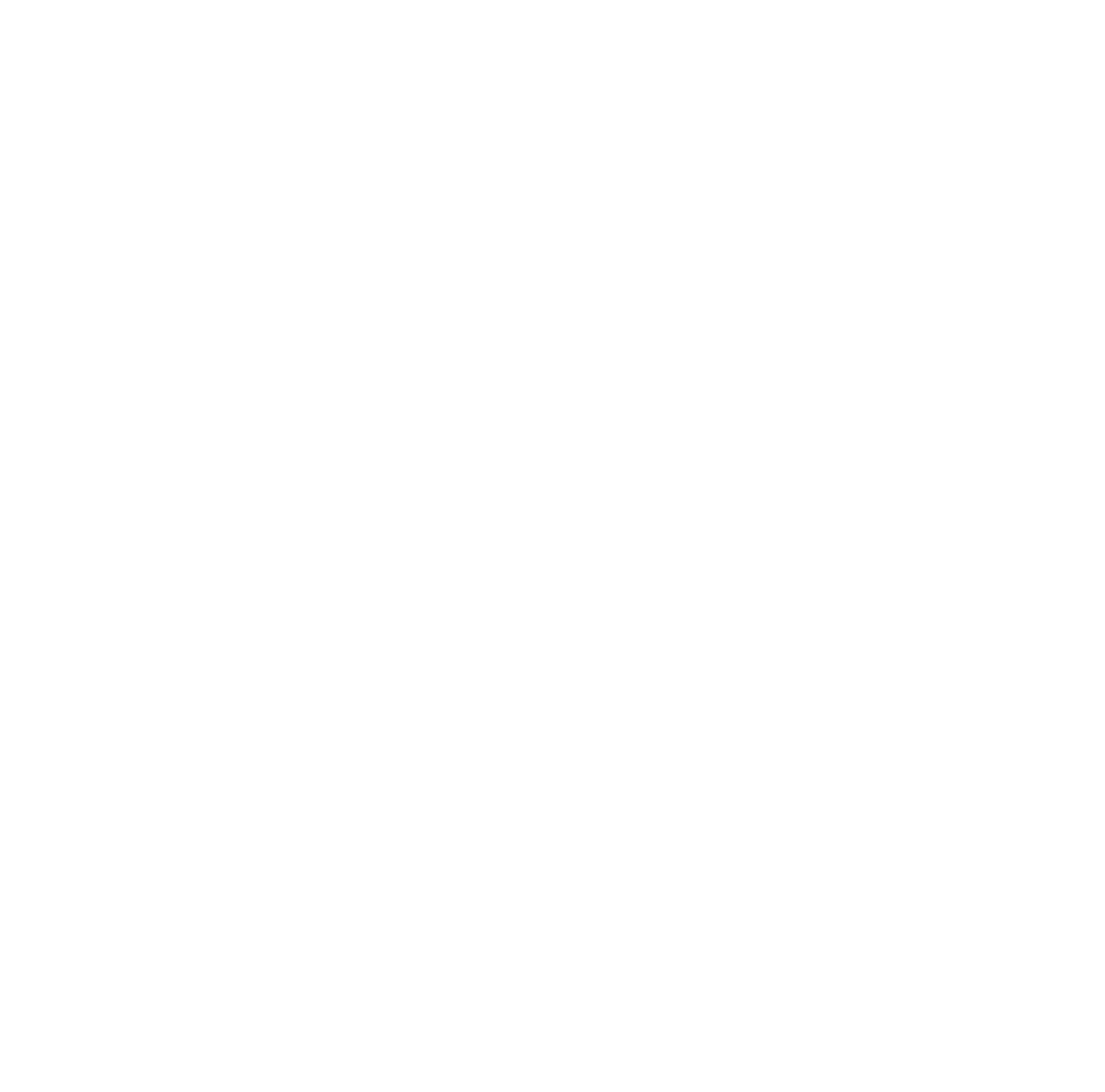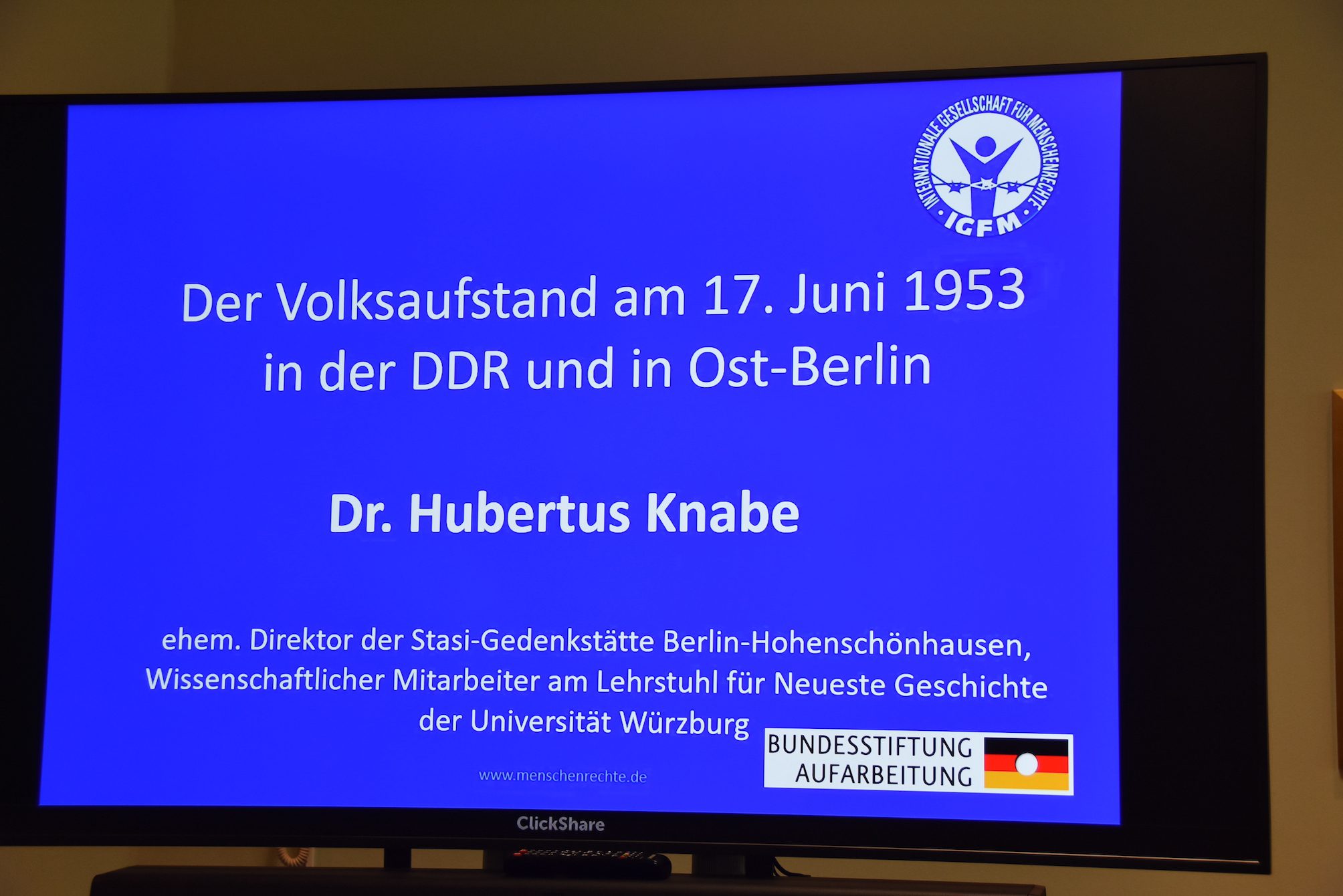Vortrag von Prof. Dr. Susanne Schröter
Leiterin Forschungszentrum „Globaler Islam“ an der Universität Frankfurt/M.
bei der IGFM-Herbsttagung 2023 in Frankfurt
zum Thema „Widerstand gegen Diktaturen in der islamischen Welt“
Widerstand gegen Diktaturen ist eine sehr schwierige Sache. Statt Demokratie entsteht vielfach erneut eine Diktatur und kein menschenrechtsorientiertes Regime. Anhand von drei Beispielen islamischer Länder wird dies deutlich:
IRAN
Im Iran hatte sich eine korrupte Monarchie entwickelt, die das Volk ausplünderte und die nationalen Ressourcen an ausländische Regierungen verkaufte. Bereits zu Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden Protestbewegungen verbunden mit vereinzelten Aufständen. Eine Koalition unterschiedlicher Akteure kennzeichnete diese Phase der iranischen Geschichte. Oberschicht wie Handwerker-Kaste waren sich einig im gemeinsamen Ziel, der Ablösung der Monarchie durch ein parlamentarisches System mit einer modernen Rechtsordnung.
Darin glich der Iran den zeitgleich stattfindenden Demokratisierungen in Europa, nicht zuletzt gab es relativ viele Kontakte zwischen Orient und Okzident in dieser Phase. Globalisierung ist somit nicht erst eine Erscheinung des 21. Jahrhunderts, sondern ist bereits vor 150 Jahren aufzeigbar.
Zu den Forderungen im Iran gehörte damals neben der Einführung von Bildung für die allgemeine Bevölkerung auch dezidiert die Mädchenbildung. Im Familienrecht sollten Frauen den Männern gleichgestellt werden. Nach Einrichtung der konstitutionellen Monarchie im Iran gelangte Reza Chan Pahlavi, der ein Mann des Volkes und ein Kosakenoffizier war, an die Macht. Er ließ sich zum Schah krönen und trug in sich die Idee einer Moderne, wenn auch nicht ein demokratisches System in unserem Sinne. Der neue autoritäre Herrscher beschränkte die Zuständigkeit der Scharia-Gerichte, führte die allgemeine Schulpflicht ein, was die Einrichtung von Mädchenschulen mit beinhaltete, und machte sich verdient um die Gründung der Teheraner Universität. Um die Aufrichtung eines Gesundheitssystems kümmerte er sich genauso wie um den Aufbau von Schienenverbindungen im Iran. Unter seiner Herrschaft wurde den Frauen auch der Zugang zur Universität ermöglicht.
Somit ist der Iran ein Beispiel dafür, dass in orientalischen Gesellschaften die Frauenrechte teilweise sehr viel früher umgesetzt worden sind als in weltlichen Gesellschaften. In puncto Familienrecht wurde der Orientierungsrahmen der Scharia verlassen, was auf Widerstand der religiösen Eliten stieß. Reza Schah Pahlavi brach mit den Traditionen bezüglich der damals für muslimische Gesellschaften üblichen Verhüllungsvorschriften der weiblichen Köpfe und Körper, was zu Auseinandersetzungen über die Entschleierung führte. Für Teile der Eliten wie für manche aus der Bevölkerung war das ein klarer Fall von Häresie oder Beleidigung des Islam. Der Schah setzte zur Durchsetzung ziemlich brachiale Mittel ein. Die Entschleierung Anfang des 20.Jahrhunderts wurde zeitweise mit polizeilicher Gewalt durchgesetzt, umgekehrt wurden bereits entschleierte Frauen auf der Straße angegriffen.
Nach der zwangsweisen Abdankung des Schahs kam noch im 2. Weltkrieg sein Sohn Mohammed Reza Pahlavi an die Macht. Dieser blieb zunächst in den Spuren seines Vaters, suchte aber zugleich den Anschluss an die Geistlichkeit. Sein Motiv war der Kampf gegen kommunistische Umsturzbewegungen. Diese führten Mitte des 20. Jahrhunderts die Opposition gegen die Monarchie an. Der neue Schah holte also beispielsweise den Großajatollah Schariatmadari nach Teheran und löste damit einen Volksauflauf Hunderttausender aus.
Trotz autoritärer Herrschaft kamen die Fortschritte für die Frauen voran, u.a. wurde das Heiratsalter auf 18 Jahre angehoben.
Angesichts der brutalen Herrschaft formte sich in den 70er Jahren eine starke Opposition, die sich aus städtisch-intellektuellen Kreisen rekrutierte. Sie schloss sowohl demokratische als auch religiöse Aktivisten ein. Es gelang dieser weit gespannten Bewegung 1979 den Schah, der sich besonders auf die USA und Großbritannien gestützt hatte, zu stürzen.
Zeitgleich mit dem Gang des bisherigen Machthabers ins amerikanische Exil kehrte Ajatollah Khomeini aus Paris in sein Heimatland zurück. Khomeini war gelungen, die breite Oppositionsbewegung zu instrumentalisieren und wandelte sie um in eine islamische Revolution, gestützt auf die religiöse Elite, die unter dem Schah stark unterdrückt war. Das gemeinsame Ziel war eine islamische Gesellschaft. Und das setzten sie durch die Gründung der Islamischen Republik Iran am 1. April 1979 um.
In der Folge wurden Frauen aus vielen Berufen vertrieben, mussten erneut den Körper mit dem Schador komplett verhüllen, damit weder von den Haaren noch vom Körper der Frauen irgendetwas zu sehen ist, um zu verhindern, dass die Männer sich verführt fühlen. Das Ansinnen richtete sich dabei auf die angebliche Gefährdung der Familie und damit letztendlich des Staates.
Zur Durchsetzung ließ man bewaffnete Milizen in den Straßen patrouillieren. Es kam zu Entlassungen von Frauen und Drohungen gegenüber Händlern, die die bisherige Praxis duldeten. Ein Monat nach Ausrufung des neuen Staates wurde die gemeinsame Erziehung von Jungen und Mädchen eingestellt. Verheirateten Frauen gestattete man nicht mehr den Besuch einer höheren Schule, geschweige denn den einer Universität. Kindertagesstätten galten fortan als Höhlen der Korruption.
Im Familienrecht wurde das Heiratsalter auf neun Jahre gesenkt, da ja schon Mohammed seine Lieblingsfrau Aischa geheiratet hatte, als sie in diesem Alter war. Wenn Frauen schon früh verheiratet werden „kommen sie auch nicht auf dumme Gedanken“, stand hinter dieser Scharia-basierten Ordnung. Außer den Frauen trafen die neuen Regeln auch Minderheiten aller Art und solche Menschen, die in irgendeiner Weise oppositionell waren.
Die von den Revolutionären zunächst abgelehnte Folter wurde beibehalten in noch viel schlimmeren Ausmaß. Zusätzlich verschärfte sich die Situation durch den Einsatz bewaffneter Milizen, als erstes zu nennen sind hier die Revolutionsgarden, die in vielen Ländern auf der Terrorliste stehen, außer in Deutschland. Sie sind schwer bewaffnet und haben komplette Kontrolle über die Wirtschaft. Hinzu kommen die sogenannten Basidsch-Milizen. Ihre Entstehung erklärt sich aus dem schon frühen Auftreten oppositioneller Gruppen, auch wenn viele Dissidenten ins Ausland auswichen.
Bei Wahlen im Iran werden die Kandidaten vorher von den religiösen Akteuren ausgewählt, bevor sie überhaupt kandidieren dürfen. Kommt es zu einem Ergebnis wie 2009, wo die Zeichen auf demokratische Öffnung standen, kann ein Wahlergebnis auch einmal nicht anerkannt werden. In diesem Fall hatten sich viele Frauen beteiligt – in der Folge fielen viele von ihnen dem Terror der Milizen zum Opfer. Im Grunde hat das Regime „komplett den Rückhalt“ in der Bevölkerung verloren. Das zeigt sich auch an der Leere der Moscheen im Iran.
Im Jahr 2018 kam es zu einer Massenbewegung der Frauen, die demonstrativ den Schleier abgezogen haben, mit der Konsequenz, dass viele schwer dafür büßen mussten. Nicht allein ist eine Unzufriedenheit mit dem Regime zu spüren, sie betrifft auch die Religion selbst. Es ist nicht so, dass sie der Meinung sind, das habe nichts mit Religion zu tun, wie man hier immer erzählt. Viele Menschen, das zeigt die Entwicklung in der Gegenwart, wünschen sich alles, nur nicht diese Form von Islam.
Auf dem Hintergrund des aktuellen Schocks angesichts der Brutalität der Hamas bei ihrem Überfall auf Israel Anfang Oktober, ist wichtig zu wissen: Khomeini hat bereits kurz nach der Machtübernahme die Beziehung zu Israel gekappt. Er hat als Staatsdoktrin festgesetzt, dass Israel zerstört und Jerusalem erobert werden muss. Darin zeigt sich der Anspruch des Iran, für alle Muslime zu sprechen, auch für die Sunniten.
Ebenso verhält es sich mit der iranischen Unterstützung beim Aufbau der Hisbollah im Libanon und der Etablierung eines Al-Quds-Tages. Dieser nach dem arabischen Namen für Jerusalem benannten Tag mit seinen Aufmärschen verweist darauf, dass die Eroberung Jerusalems durch Muslime anzustreben sei, gleiches gilt für die Vertreibung der Juden. In dieser Logik gilt dann auch: Antisemitismus und Islamismus hängen ganz essentiell zusammen. Islamismus ist immer antisemitisch.
Tunesien
Vergleichbar mit der des Iran ist die Entwicklung im nordafrikanischen Tunesien verlaufen. Auch dort wurden schon früh reformorientierte Intellektuelle aktiv, in diesem Fall gegen das französische Kolonialregime. Am Anfang stehen dort die Bemühungen von Taher Haddad, der eine Reinterpretation der islamischen Quellen forderte, dass sie kompatibel sind mit einer Moderne, die menschenrechtsorientiert ist, ohne allerdings sich explizit auf niedergelegte Menschenrechte zu beziehen. Der Einstieg erfolgte wie im Iran beim Familienrecht und der Mädchenbildung. Infolgedessen musste Haddad heftigen Gegenwind in Kauf nehmen, ist als Häretiker denunziert worden und hat seine Lehrbefugnis verloren.
Auch nach Haddads Tod Mitte der 1930er Jahre blieb das Reformprogramm lebendig in den Köpfen vieler Intellektueller. Bei der Unabhängigkeit des Landes im Jahr 1957 griff der neue Staatspräsident Habib Bourguiba Gedanken Haddads wieder auf. Ähnlich wie zuvor in der Türkei und im Iran, islamischen Ländern also, wurde nun in Tunesien versucht, einen modernen Staat aufzubauen.
Bourguiba, verheiratet mit einer Französin, brachte sich dabei ein als Absolvent der Politikwissenschaft an der Sorbonne. Er orientierte sich am Laizismus, begrenzte den Einfluss der religiösen Akteure und hob religiöse Stiftungen, die erheblichen Einfluss besaßen, auf.
Nach Abschaffung der Scharia-Gerichte wurde ein säkulares Justizsystem etabliert und das gesamte Bildungssystem säkularisiert. Bourguiba unterstützte die Emanzipationsbewegung der Frauen, indem er ein fortschrittliches Personenstandsrecht schuf, so dass Frauen selbständig reisen und eigene Bankkonten eröffnen konnten. Gemessen an den Verhältnissen hierzulande kurz nach dem Krieg ist dies recht progressiv zu nennen. Tunesien führte auch die Zivilehe ein und schaffte die Mehrehe ab. Das tunesische Modernisierungsprogramm kann als Emanzipation von oben gelten, auf den Weg gebracht von einer autoritären Regierung. Wenig demokratische Elemente wies Tunesien damals auf.
In denselben Gleisen setzte Zine el-Abidine Ben Ali, Bourguibas Nachfolger ab 1987, die Arbeit fort. Aufgrund schlechter Wirtschaftsbedingungen war seine Regierung weit weniger beliebt. Dies nutzten die religiösen Eliten auf politischer Ebene. Ihr Instrument war die Ennahda, eine an der ägyptischen Muslimbruderschaft orientierten Bewegung. Wie bei deren Gründung 1928 in Ägypten war auch hier das Ziel, das Land vor einer Säkularisierung zu bewahren mit einem Scharia-orientierten, fundamentalistischen, frauenfeindlichen und auch antisemitischen Programm. Rached al-Ghannouchi, der Vorsitzende der Ennahda, hat sich als Antisemit eingesetzt für palästinensische Terroristen, beides Kennzeichen vieler antimodernen islamistischen Bewegung. Ghannouchis Ziel war, die patriarchalische Geschlechterordnung zu konservieren.
In Tunesien startete 2010 jene arabische Revolution, die man den Arabischen Frühling nennt. Auslöser war der wirtschaftliche Niedergang und der Polizeiterror dort. Die Selbstverbrennung des Gemüsehändlers Mohamed Bouazizi war Auslöser für eine Welle der Auflehnung gegen jede Art von Diktatur in der arabischen Welt. Westliche Erwartungen, dass es in der Folge zu einer Demokratisierung in diesen Ländern komme, wurden enttäuscht, da bei freien Wahlen überall Islamisten an die Macht kamen. In Tunesien trug die Ennahda den Sieg davon, gefolgt von Übergriffen auf säkulare Institutionen und unverschleierte Frauen.
Den Koran als Grundlage der Verfassung konnte man aber nicht durchsetzen, weil es eine breite säkulare Bewegung – bis heute – verhindert hat. Doch Tunesien hat auch etliche militante Anhänger des Islamischen Staates (IS) hervorgebracht. Gegenwärtig ist die Ennahda weitgehend entmachtet, der aktuelle Präsident Kais Saied knüpft erneut an am Prinzip des säkularen Autoritarismus. Trotz starker Zivilgesellschaft gelang es auch in Tunesien nicht der Demokratisierung den Weg zu bereiten.
Indonesien
Als weltweit fortschrittliches Land, was die Synthese aus Islam und Demokratie angeht, gilt häufig fälschlicherweise Indonesien. Dort spielten muslimische Organisationen nach den antikolonialen Kämpfen gegen Niederländer eine besondere Rolle, mit dem Ziel, Indonesien zu einem islamischen Staat zu machen. Nach der Unabhängigkeit regierte Präsident Sukarno die gelenkte Demokratie Indonesien diktatorisch. Sukarno propagierte den „multikulturellen und multireligiösen Staat“, bis in die Präambel der Verfassung hinein.
Es entbrannte jedoch ein 1 ½ Jahrzehnte währender Bürgerkrieg zwischen islamischen und nationalen Milizionären. Am Ende wurde in Indonesien der politische Islam verboten. Suhartos autoritärer Kurs richtete sich gegen kommunistische Akteure, die 1965/66 an einem bis heute ungeklärten Putschversuch beteiligt waren. Dessen Folge waren antikommunistische Massaker, denen eine halbe Million Menschen zum Opfer fiel.
Ein weiteres Resultat war die Machtübernahme durch General Suharto, der beim Ziel den politischen Islam zu verbieten im Kurs seines Vorgängers blieb. Auf die Dauer ermangelte es Suharto am Rückhalt in der Armee. Auch dort hatten sich islamische Parolen zu entfalten begonnen. Suhartos Versuch, Frieden mit dem Islam zu schließen führte dazu, dass als Konzession die Verschleierung erlaubt wurde und ein islamisches Geldinstitut sich gründen konnte. Auch Suhartos Wallfahrt nach Mekka konnte seine Sympathiewerte nicht steigern. Er wurde 1998 von einer breiten Demokratiebewegung gestürzt.
Daraufhin konnten die islamistischen Akteure aus dem Untergrund auftauchen mit öffentlichkeitswirksamen Demonstrationen. So wurde z.B. ein Antipornografie-Gesetz gefordert, wonach Frauen verboten wird, Kleidung zu tragen, die auf Männer sexuell erregend wirkt, also alles außer Ganzkörperverschleierung. Wegen der starken indonesischen Demokratiebewegung kam es bislang nicht zur Machtübernahme der Islamisten. Staatliche Stellen werden jedoch zunehmend infiltriert. Im Bundesstaat Ace konnte die Scharia flächendeckend eingeführt werden, dort kommt es zu öffentlichen Auspeitschungen, ist die Vollverschleierung Pflicht und Frauen dürfen am Abend nicht aus dem Haus ohne Begleitung ihrer Männer.
Durch den Sieg von islamistischen Parteien droht sich Indonesien durch zu schließende Kompromisse zu verändern, immer islamistischer zu werden. Es gilt allgemein der Grundsatz, jeder müsse eine Religion haben. Auch ist der Säkularismus verboten. Zur Liste der erlaubten Religionen gehört das Judentum in Indonesien nicht. Die Kuratorengruppe Ruan Grupa, die auf der Kunstaustellung Documenta 2022 einen antisemitischen Skandal auslöste, kam aus Indonesien. Aus Kreisen der Südostasien-Wissenschaft kam zur Verteidigung, sie hätten das als antikoloniale Geschichte gemeint.
Aktuell machen zwei der ehemaligen Documenta-Kuratoren – inzwischen als Kunstprofessoren in Norddeutschland – wieder von sich reden, weil sie pro-Hamas-Äußerungen im Internet befürwortet haben. Das übergreifende Dilemma im islamischen Kontext besteht darin, dass Widerstand gegen säkulare Diktaturen häufig islamischen Diktaturen den Weg bereitet. In deren Klima gedeiht sowohl Antisemitismus als auch unverblümter Israel-Hass. Auch in Indonesien ist Hitlers „Mein Kampf“ in Übersetzung erschienen. Als deutscher Staatsbürger erfährt man dort eine besondere Wertschätzung, weil sie Deutsche mit dem Nationalsozialismus in Verbindung bringen.