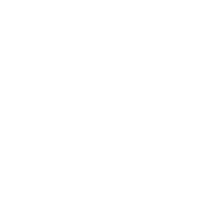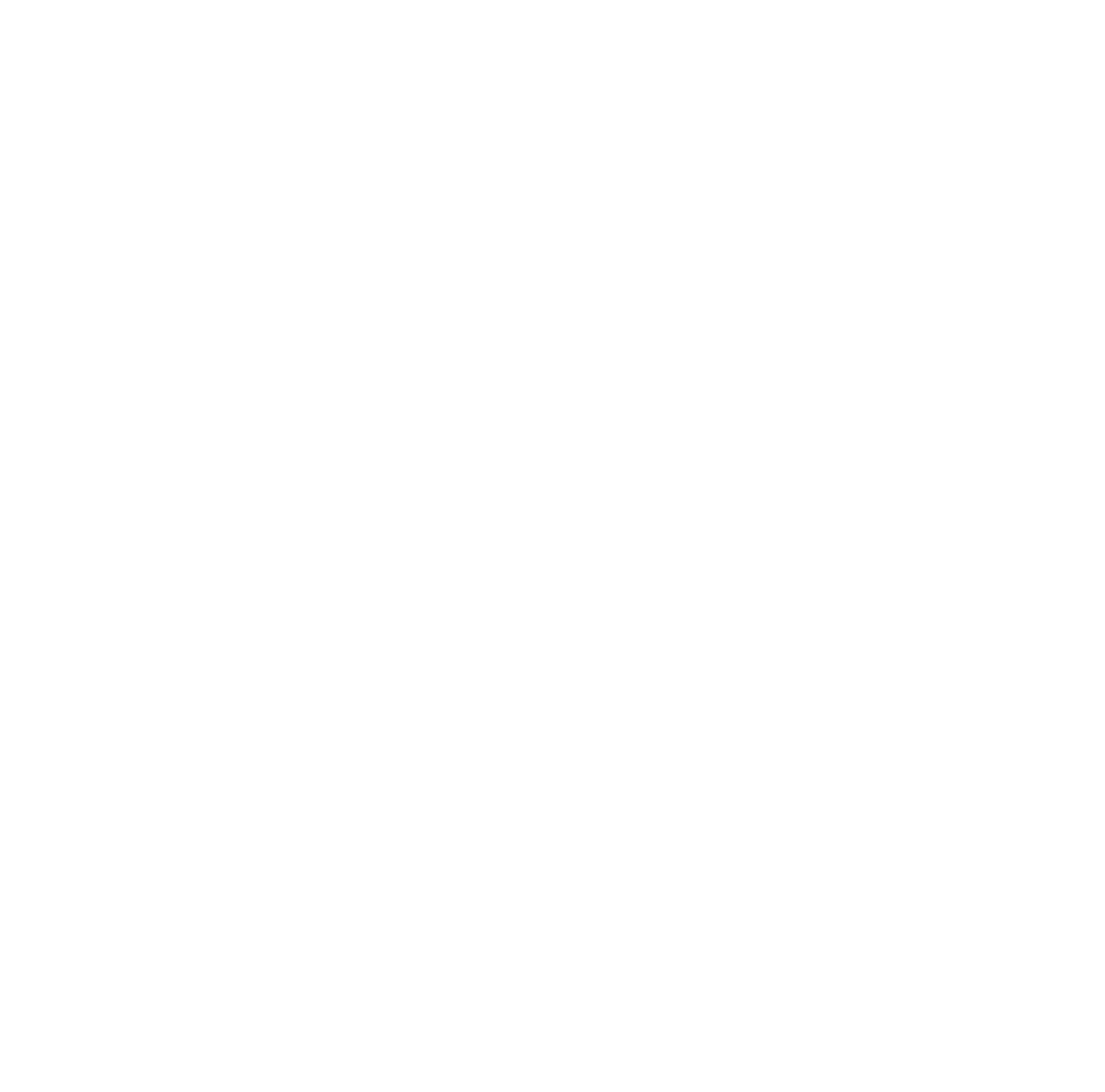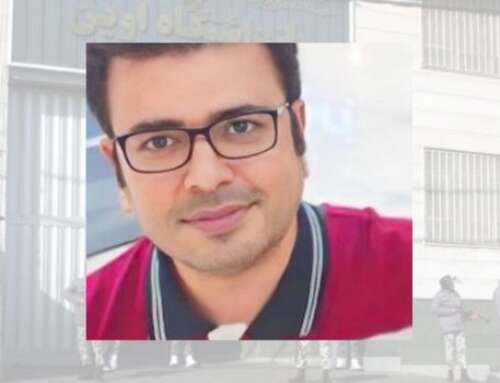Der 1937 in Shanghai geborene Harry Wu wurde 1956 von der chinesischen Volksregierung als politischer Gefangener – ohne Gerichtsurteil – in das Laogai, das chinesische Zwangsarbeitslagersystem, eingewiesen. Im Laogai verbrachte er 19 Jahre seines Lebens. Im Interview spricht der bekannte chinesische Menschenrechtler über das Laogai-Lagersystem.
Interview mit dem Direktor der Laogai Research Foundation Harry Wu
Interview vom Oktober 2018
Zur Person
Harry Wu verbrachte 19 Jahre seines Lebens in insgesamt 12 verschiedenen Lagern. Dort wurde er gezwungen, in Chemiefabriken, Bergwerken, im Straßenbau und in der Landwirtschaft zu arbeiten. Er überlebte Prügel, Folter, Einzelhaft, Trinkwasserentzug, Hunger und sah den Tod vieler Mitgefangener. Nach seiner Entlassung 1979 zog Wu in die Vereinigten Staaten, entschlossen, die Wahrheit über das Laogai, das größte Zwangsarbeiter-System der Welt, zu verbreiten. Er ist mehrfach nach China gereist, um Sklaverei und Menschenrechtsverletzungen zu dokumentieren und hat dabei sein Leben riskiert.
Wu hat vor vielen Komitees des US-Kongresses ausgesagt, ebenso vor den Parlamenten Englands, Frankreichs, Deutschlands und Australiens, dem Europäischen Parlament und vor UN-Organen. Er ist Autor mehrerer Bücher wie „Laogai – Der Chinesische Gulag“, einer wissenschaftlichen Analyse des Laogai-Systems im Kommunistischen China, sowie dem internationalen Bestseller „Bitter Winds“, einer eindrucksvollen Dokumentation seiner Gefangenschaft und außerordentlichen Mutes.
1995 wurde Wu in China festgenommen, des Verrats von Staatsgeheimnissen beschuldigt und zu 15 Jahren Gefangenschaft verurteilt. Dank amerikanischer Intervention wurde er schließlich ausgewiesen. Seit seiner Ausweisung kämpft Wu weiter dafür, dass die Menschenrechtsverletzungen in der Volksrepublik China wahrgenommen werden. Für seine Arbeit hat Wu zahlreiche internationale Auszeichnungen erhalten, u. a. den Menschenrechts-Preis der Harvard-Stiftung.
Harry Wu ist am 26. April 2016 im Alter von 79 Jahren verstorben. Die IGFM gedenkt in einem Nachruf dem Menschenrechtler und seinem beeindruckenden Vermächtnis.

Harry Wu war Gründer und leitender Direktor der Laogai Research Foundation in Washington DC. Die Nicht-Regierungs-Organisation dokumentiert das Laogai-System und weitere Menschenrechtsverletzungen, wie politisch motivierte Hinrichtungen und Organhandel. Wu war Mitglied des IGFM Kuratoriums.
Harry Wu zum Lagersystem der Volksrepublik China
Herr Wu, für uns Europäer erscheinen die Dimensionen häufig erschreckend groß mit denen man in China konfrontiert wird. Wie viele Menschen sind zurzeit im Laogai-System, den chinesischen Zwangsarbeitslagern, inhaftiert?
Harry Wu: Diese Frage kann ich konkret nur sehr schwer beantworten. Alle Informationen, die das Laogai-Zwangsarbeitslagersystem betreffen, werden von den kommunistischen Machthabern bis heute als Staatsgeheimnis streng gehütet. Wenn ich trotzdem eine Schätzung abgeben müsste, würde ich derzeitig von etwa vier Millionen Gefangenen im gesamten Zwangsarbeitslagersystem ausgehen. Bei der Laogai Research Foundation versuchen wir sehr sorgfältig Informationen zusammenzutragen und zu verifizieren. Unsere Schätzungen sind sehr konservativ und ich befürchte, dass die Zahl der Gefangenen auch deutlich höher liegen könnte.
Das Laogai-System besteht mittlerweile seit mehr als einem halben Jahrhundert. Können Sie etwas über die historischen Dimensionen des Zwangsarbeitslagersystems sagen? Zum Beispiel, wie viele Menschen bisher insgesamt in den Laogai-Lagern inhaftiert waren und wie viele die Zwangsarbeit nicht überlebt haben?
Harry Wu: Die Kommunisten unter Mao [Zedong] begannen mit der Errichtung von Zwangsarbeitslagern im Prinzip unmittelbar nach ihrer Machtergreifung 1949. Zu diesem Zeitpunkt war die soziale und wirtschaftliche Lage in China katastrophal und die Infrastruktur war weitestgehend zerstört. Das Land hatte viele Jahre Bürgerkrieg erlitten, aus dem die Kommunisten schließlich als Sieger gegen die Kuomintang [Anmerkung: Chinesische Nationalisten] hervorgegangen waren.
Die Sowjetunion unter Stalin bot sich als natürlicher Verbündeter an und leistete in den darauffolgenden Jahren maßgeblich Unterstützung beim kontinuierlichen Aufbau des Laogai-Systems. Der sowjetische Gulag diente in vielerlei Hinsicht als Vorbild für das Laogai-System, das es so vorher in China noch nicht gegeben hatte. In diesem Zeitraum, der bis heute mehr als 50 Jahre misst, sind vermutlich insgesamt bis zu 50 Millionen Menschen in China als Häftlinge in diesem Lagersystem missbraucht worden.
Eine unglaublich erschreckend hohe Zahl … Wie viele von den Millionen Häftlingen haben die Zwangsarbeit nicht überlebt?
Harry Wu: Diese Frage kann ich leider wieder nur sehr schwer beantworten und ich würde es gerne vermeiden eine ungenaue Schätzung abzugeben. Ich kann ihnen aber ein Beispiel nennen, anhand dessen man die mörderischen Ausmaße des Laogai-Systems erahnen kann. 1955 zwang die kommunistische Regierung zwei Millionen Laogai-Häftlinge aus den Provinzen Jiangsu, Zhejiang und Shanghai an Flussbegradigungen und Dammarbeiten am Huai Fluss. Von diesen ursprünglich zwei Millionen Häftlingen war ein Jahr später in offiziellen Dokumenten nur noch von etwa der Hälfte die Rede.
Unsere Analyse der Dokumente und unser Wissen über die damaligen Umstände lassen den Schluss zu, das eine Million Häftlinge allein bei diesem Zwangsarbeitsgroßprojekt ums Leben kamen. Wie man heute ebenfalls im Ausland weiß, sind allein zur Zeit des „Großen Sprungs nach Vorne“ viele Millionen Chinesen aufgrund von Misswirtschaft, durch Zwangsmaßnahmen verursachte Missernten und auch durch Zwangsarbeit ums Leben gekommen.
Wer waren und sind denn die eigentlichen Opfer des Laogai-Systems? Was haben sie sich aus Sicht der chinesischen Regierung zu Schulden kommen lassen?
Harry Wu: Mit zu den ersten Opfern der Zwangsarbeit gehörten Mitglieder und Sympathisanten der Kuomintang, [Anmerkung: jener Partei, die den Kommunisten im Bürgerkrieg unterlegen war]. Aus ideologischer Sicht der Kommunisten stellte aber auch die sogenannte Bourgeoise eine grundsätzliche Bedrohung dar, die es zu beseitigen galt. Damals in China wurden hauptsächlich Großgrundbesitzer und wohlhabendere Bauern der bourgeoisen Klasse zugeordnet, aber auch beispielsweise Kaufleute.
Die kommunistische Partei entwickelte in den fünfziger Jahren auch eine sehr starke Paranoia gegen sogenannte Konterrevolutionäre. Zu diesen zählten tatsächliche Dissidenten und Oppositionelle des Systems, jedoch auch parteiinterne Kritiker, die zuvor von Mao noch ermutigt worden waren, Verbesserungsvorschläge zu unterbreiten und offen Kritik zu üben.
Nun hat es seit dem Tode Maos und dem darauffolgenden Reformkurs Deng Xiaopings glücklicherweise einige positive Veränderungen in China gegeben. Ich vermute auch in Hinblick auf das Laogai-System? Welche Personen werden heute zur Zwangsarbeit verurteilt und was wird ihnen vorgeworfen?
Harry Wu: Bei der Mehrzahl der Häftlinge handelt es sich heute in der Tat um Kriminelle, die mehr oder weniger schwerwiegende Vergehen begangen haben. Allerdings dient das Laogai-System der kommunistischen Partei immer noch als wichtiges Instrument der Unterdrückung und Machterhaltung. Unter den Laogai-Häftlingen befinden sich weiterhin viele Dissidenten jeglicher Art. Dazu gehören Angehörige religiöser und ethnischer Minderheiten wie Tibeter, Uiguren, verfolgte Christen und Falun Gong Praktizierende, aber auch Gewerkschafter, Anwälte, Petitionssteller oder Anhänger der Demokratiebewegung.
China ist heute noch sehr weit davon entfernt, ein Rechtsstaat zu sein, und auf dem Gebiet der Menschenrechte stagniert die Entwicklung zurzeit. Auf Grundlage der sogenannten Administrativhaft zum Beispiel werden weiterhin viele Menschen ohne Gerichtsverfahren zur Zwangsarbeit verurteilt.
Könnten Sie bitte die Praxis der Administrativhaft näher erläutern?
Harry Wu: Die Administrativhaft ist eine Haftstrafe mit Zwangsarbeit, ohne Gerichtsverfahren und ohne Möglichkeit für die Opfer, sich zu verteidigen. Den wenigsten Menschen im Westen ist bewusst, dass es so etwas heute noch gibt: Haftstrafen ohne eine Möglichkeit zur Verteidigung. Auch danach haben die Häftlinge keine Möglichkeit, in Berufung zu gehen oder andere Rechtsmittel einzulegen.
Administrativhaft kann bereits von einer einfachen Polizeidienstelle verhängt werden, und das Strafmaß beträgt in der Regel bis zu vier Jahre Haft in einem Zwangsarbeitslager. In einigen Fällen kann das verhängte Strafmaß auch noch über vier Jahre hinaus gehen. Die Arbeitslager, in die speziell Verurteilte durch Administrativhaft gesperrt werden, heißen in chinesischer Kurzform übrigens „Laojiao“, das bedeutet sinngemäß übersetzt „Umerziehung durch Arbeit“.
Streng genommen bezieht sich der Name Laogai – der eine chinesische Kurzform für „Reform durch Arbeit“ ist – nur auf Zwangsarbeitslager, in denen Häftlinge ihre Haft verbüßen, die zuvor von einem ordentlichen Gericht verurteilt wurden. Zugleich wird der Begriff „Laogai“ aber auch einfachheitshalber als Synonym für das gesamte chinesische Arbeitslagersystem mit all seinen Komponenten verwendet.
Welche weiteren Komponenten gibt es denn noch im Laogai-System?
Harry Wu: Neben Laojiao und Laogai gibt es zum Beispiel noch „Kanshousuo“, eine Art Untersuchungsgefängnis. Sie können dieses Untersuchungsgefängnis aber ganz gewiss nicht mit einem deutschen Untersuchungsgefängnis vergleichen, in dem Beschuldigte über einen überschaubaren Zeitraum hinweg auf einen fairen Prozess warten. In der Volksrepublik werden Kleinkriminelle, verurteilte Schwerverbrecher, die auf ihre Exekution warten und potenziell zu Unrecht Beschuldigten über Monate hinweg zusammengesperrt.
Die kommunistische Regierung hat auch Deportationslager für eigene Staatsbürger eingerichtet! Die Lager tragen den Namen „Shourong Qiansong“. Wie sie möglicherweise wissen, gibt es in China ein sehr rigides System der Wohnsitzkontrolle, das ursprünglich darauf abzielte, die ärmere Landbevölkerung aus den Städten fernzuhalten. Aufgrund des enormen Wirtschaftsbooms ist jedoch eine starke Nachfrage nach billigen Arbeitskräften entstanden. Daher ließ es die Pekinger Regierung zu, dass in den letzten Jahrzehnten eine enorme Binnenmigration vom Land in die Städte einsetzte. Da die Regierung aber weiterhin Kontrolle ausüben möchte und die enormen sozialen Kosten scheut, die eine solche Migrationswelle mit sich bringt, bleibt ein großer Teil der Wanderarbeiter rechtlos. Dies gilt für soziale Leistungen des Staates, aber auch gegenüber der Justiz. Mit „Shourong Qiansong“ wurde ein System geschaffen mit dem man glaubte, dass man die sozialen Probleme, die die Binnenmigration mit sich bringt, mit Gewalt lösen kann.
In der Volksrepublik gibt es auch Jugendhaftanstalten in denen die jugendlichen Insassen täglich Zwangsarbeit verrichten müssen. Die Altersuntergrenze beträgt zurzeit vierzehn Jahre und wurde damit sogar noch um zwei Jahre abgesenkt. Die Haftbedingungen in den verschiedenen Lagern können sich übrigens erheblich voneinander unterscheiden.
Herr Wu, Sie waren selbst 19 Jahre lang ein Laogai-Häftling. Wie muss man sich dort die Haftbedingungen vorstellen?
Harry Wu: Überfüllt … die Lager, in denen ich inhaftiert war, waren völlig überbelegt mit Häftlingen. In den Gruppenzellen hatten die Häftlinge vielleicht eine Fläche für sich allein, die ein Meter mal zwei Metern entspricht. Es war auch immer furchtbar kalt und dreckig in den Zellen… Die tägliche Zwangsarbeit zog sich immer über den ganzen Tag hin, von morgens bis abends. Die Gefangenen werden an verschiedenen Orten zu unterschiedlichen Aufgaben eingesetzt. Dazu gehörte Arbeit in Bergwerken, in Steinbrüchen, in der Landwirtschaft oder in Industriebetrieben.
War die Arbeit dabei auch lebensbedrohlich?
Harry Wu: Ja… (längeres Schweigen)
„Laogai“ bedeutet sinngemäß übersetzt „Reform durch Arbeit“. Könnten Sie diesen Aspekt näher erläutern?
Harry Wu: Zu Maos Zeiten strebten die Kommunisten nicht nur die politische und wirtschaftliche, sondern auch die ideologische Kontrolle über die Menschen an. Ein wichtiger Grund für die Errichtung des Laogai-Systems lag auch darin, diese Kontrolle über die Köpfe der Menschen durchzusetzen. Durch die physisch zermürbende Zwangsarbeit sollte der eigenständige Wille der Menschen gebrochen werden. Zwangsarbeit und Folter waren jedoch nicht die einzigen Methoden, um die Gedanken der Häftlinge im Sinne des Staates zu „reformieren“. In den Arbeitslagern wurden täglich mehrstündige ideologische Schulungen mit politischer Propaganda durchgeführt und Häftlinge wurden dazu genötigt, Schuldgeständnisse abzulegen.
Die kommunistische Partei ist heute weitgehend entideologisiert und sie kümmert sich deutlich weniger darum, was die Leute in ihren Köpfen denken, solange sie es für sich behalten. Aber bei einigen Opfergruppen, wie beispielsweise ethnische und religiöse Minderheiten spielt die „Gedanken Reform“ allerdings heute immer noch eine Rolle. So werden gläubige Christen in manchen Fällen dazu genötigt, in schriftlicher Form ihren Glauben zu widerrufen. Auch werden viele Häftlinge weiterhin unter Druck gesetzt, Schuldgeständnisse abzuliefern.
Glauben Sie, dass eine Möglichkeit besteht, dass das Zwangsarbeitslagersystem in China in Zukunft aufgelöst werden wird?
Harry Wu: Ich bin leider fest davon überzeugt, dass das Laogai-System erst dann beseitigt werden wird, wenn die Kommunistische Partei nicht mehr die alleinherrschende politische Macht in China ist. Wann es allerdings dazu kommen wird, das vermag ich leider nicht zu sagen. Das mag in zehn Jahren sein, aber vielleicht wird es auch noch zwanzig oder dreißig Jahre dauern…
Hat denn die chinesische Regierung in den letzten Jahren wirklich keinerlei Reformansätze unternommen, um die Justizwillkür und die Menschenrechtsverletzungen in den Arbeitslagern zumindest graduell einzudämmen?
Harry Wu: Die kommunistische Regierung hat in der Tat eine Reform bezüglich Laogai in ihrer jüngeren Geschichte verabschiedet. 1994 wurde der Name „Laogai“ aus dem offiziellen Wortschatz der Regierung gestrichen. Den Begriff so wie wir [die Laogai Foundation] oder die IGFM ihn benutzen, werden Sie in offiziellen staatlichen Dokumenten nach 1994 nicht mehr finden. Heute werden die Lager im offiziellen Wortlaut nur noch als „Jianyu“ [Anmerkung: zu Deutsch „Gefängnisse“], bezeichnet. Aber leider handelt es sich bei dieser Namensreform nur um einen rein kosmetischen Schritt. Auch andere Reformen, die im Laufe der letzten Jahre vollmundig von der Regierung in Peking angekündigt wurden, haben meiner Einschätzung nach zu keinen entscheidenden Verbesserungen für die Betroffenen geführt.
Die kommunistische Regierung arbeitet übrigens mit ähnlichen Publicity-Tricks im Umgang mit der Todesstrafe. 2005 wurden öffentliche Exekutionen verboten und die Behörden sind im Moment dabei, die Erschießungskommandos schrittweise durch Giftspritzen zu ersetzen, die man im Westen als humanere Form der Todesstrafe ansieht. Die Regierung bleibt allerdings weiterhin völlig intransparent, was die Anzahl und die Umstände der Exekutionen in China angeht. Anhand der öffentlichen Hinrichtungen waren einige NGOs in der Lage, Schätzungen über das Ausmaß der Todesstrafe anzustellen. Ich könnte mir vorstellen, dass darin der eigentliche Grund hinter dem Verbot der öffentlichen Exekutionen liegt.